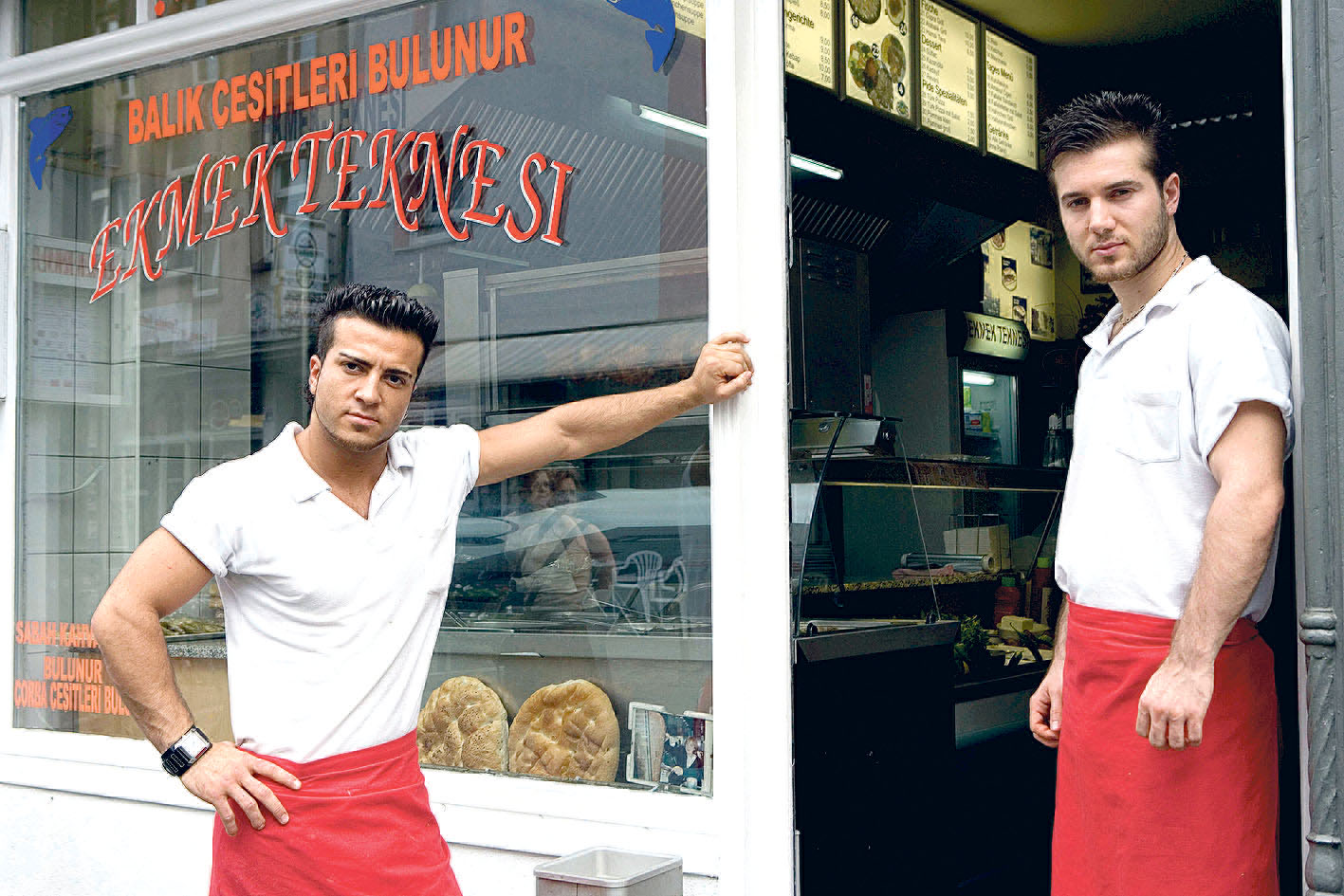BERLIN – Sind die Migranten aus der Türkei nach Jahrzehnten in Deutschland wirklich angekommen? Die Befunde einer jetzt in Berlin veröffentlichten Emnid-Umfrage mit dem Titel „Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland“ ergeben ein widersprüchliches Bild: Gut 90 Prozent der hier lebenden Türkischstämmigen fühlen sich demnach sehr wohl in der Bundesrepublik, und die Mehrheit auch gerecht behandelt, aber mehr als die Hälfte sieht sich sozial nicht anerkannt und als „Bürger zweiter Klasse“; 87 Prozent fühlen sich „eng oder sehr eng“ mit Deutschland verbunden, aber fast ebenso viele mit der Türkei.
Islamisch-fundamentalistische Einstellungen sind unter ihnen verbreitet, aber die große Mehrheit hat eine positive Haltung zu Christen. Die zweite und dritte Generation ist laut Studie gut integriert. Integration bedeutet für sie aber auch, „selbstbewusst zu seiner eigenen Kultur, eigenen Herkunft stehen“.
28 Prozent mit deutscher Staatsangehörigkeit
Der Leiter der Studie, der Münsteraner Religionssoziologe Detlef Pollack, sieht vor allem eine „Diskrepanz zwischen dem Gefühl, angekommen zu sein“ und fehlender gesellschaftlicher Wertschätzung. Darauf führte er auch zurück, „dass man den Islam vehement verteidigt“. Bei der mangelnden Wertschätzung spielt die eigene Religion eine „sehr große Rolle“, so der Mitautor der Studie, Nils Müller.
Für die Untersuchung befragte das Meinungsforschungsinstitut im Auftrag des Exzellenzclusters „Religion und Politik" der Universität Münster zwischen November 2015 und Februar 2016 gut 1200 Zuwanderer aus der Türkei und ihre Nachkommen im Alter ab 16 Jahren per Telefon. Die Befragten der ersten Generation leben im Durchschnitt seit 31 Jahren in Deutschland. 40 Prozent der Befragten wurden in Deutschland geboren. 28 Prozent haben die deutsche Staatsbürgerschaft, 58 Prozent die türkische, acht Prozent haben einen deutschen und einen türkischen Pass, fünf Prozent einen türkischen und einen weiteren.
Islamische Gesetze wichtiger als deutsche
Laut Statistischem Bundesamt lebten 2014 rund 2,9 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland. Die Studie umfasst aber auch Angehörige der zweiten und dritten Generation, die in der Statistik des Amtes nicht enthalten sind.
Die Befragten schrieben dem Islam vor allem positive Eigenschaften wie Toleranz und Friedfertigkeit zu (siehe auch Kasten rechts). Über 80 Prozent machte es wütend, dass nach einem Terroranschlag als erstes Muslime ver-dächtigt würden. Drei Viertel plädierten für ein Verbot von Büchern und Filmen, die Gefühle tief religiöser Menschen verletzen. Gleichzeitig meinten zwei Drittel, der Islam passe in die westliche Welt. Die Einschätzung der Gesamtbevölkerung ist aber geradezu umgekehrt. „Hier haben wir wirklich einen Konflikt“, so Pollack.
Tatsächlich sind laut Studie fundamentalistische Einstellungen unter den Türkischstämmigen weit verbreitet. Für knapp die Hälfte der Befragten gibt es nur „eine wahre Religion“, und für sie ist Befolgung islamischer Gebote wichtiger als die deutschen Gesetze. Ein Drittel meint, Muslime sollten zur Gesellschaftsordnung in Mohammeds Zeiten zurückkehren. 36 Prozent zeigten sich überzeugt, nur der Islam könne die Probleme der Zeit lösen. Ein verfestigtes fundamentalistisches Weltbild liegt der Erhebung zufolge bei 13 Prozent vor. Pollack nannte es „schon beachtlich, wie hoch die Gewaltakzeptanz ist“.
Der Soziologe verwies aber auch darauf, dass fundamentalistische Einstellungen in der zweiten und dritten Generation rückläufig sind. Hier zeigten sich durchaus Integrationserfolge durch Bildung, Arbeitswelt und einen engeren Kontakt zu Deutschen. Dass sich die zweite und dritte Generation für religiöser hält als ihre Eltern, führte er auf eine „kulturelle Selbstbehauptung“ zurück, eine „Inszenierung“ von Religion. Denn die religiöse Praxis ist bei der jüngeren Generation wiede-rum rückläufig. Die Entwicklung einer Parallelgesellschaft wollte Pollack in den Ergebnissen nicht sehen. Eher die Erkenntnis, dass Integration weit über Bildung und Arbeitsmarkt hinausgeht.
Mehr gegenseitiges Verständnis nötig
Im Fazit der Studie heißt es, für eine umfassende und nachhaltige Integration der Türkeistämmigen, aber auch mit Blick auf den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt müsse das Augenmerk nicht nur auf die strukturelle Ebene gerichtet werden. Mindestens ebenso notwendig seien „Veränderungen auf der Ebene der Wahrnehmung und Anerkennung“. Ein erster Schritt zum Gelingen sei dabei das Bemühen, den anderen zu verstehen.
Dabei seien, so heißt es, beide Seiten gefordert: Die deutsche Mehrheitsbevölkerung sollte mehr Verständnis für die „spannungsreichen Probleme“ der Zugewanderten und ihrer Kinder aufbringen, sich in die deutsche Gesellschaft einzufügen, ohne die Prägungen ihrer Herkunftsgesellschaft zu verleugnen. Zudem sollte sie sich ein differenzierteres Bild von Muslimen und vom Islam machen und zur Kenntnis nehmen, dass eine Mehrheit der in Deutschland lebenden Türkeistämmigen keine dogmatischen Haltungen vertritt,.
Andererseits, so das Fazit der Autoren der Studie, sollten die Türkeistämmigen mehr Verständnis für die Vorbehalte in der deutschen Mehrheitsgesellschaft aufbringen und auf sie nicht nur mit Verteidigung und Empörung reagieren, sondern sich auch kritisch mit fundamentalistischen Tendenzen in den eigenen Reihen auseinandersetzen.
• Die Studie im Internet: https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/religion_und_politik/aktuelles/2016/06_2016/studie_integration_und_religion_aus_sicht_t__rkeist__mmiger.pdf.