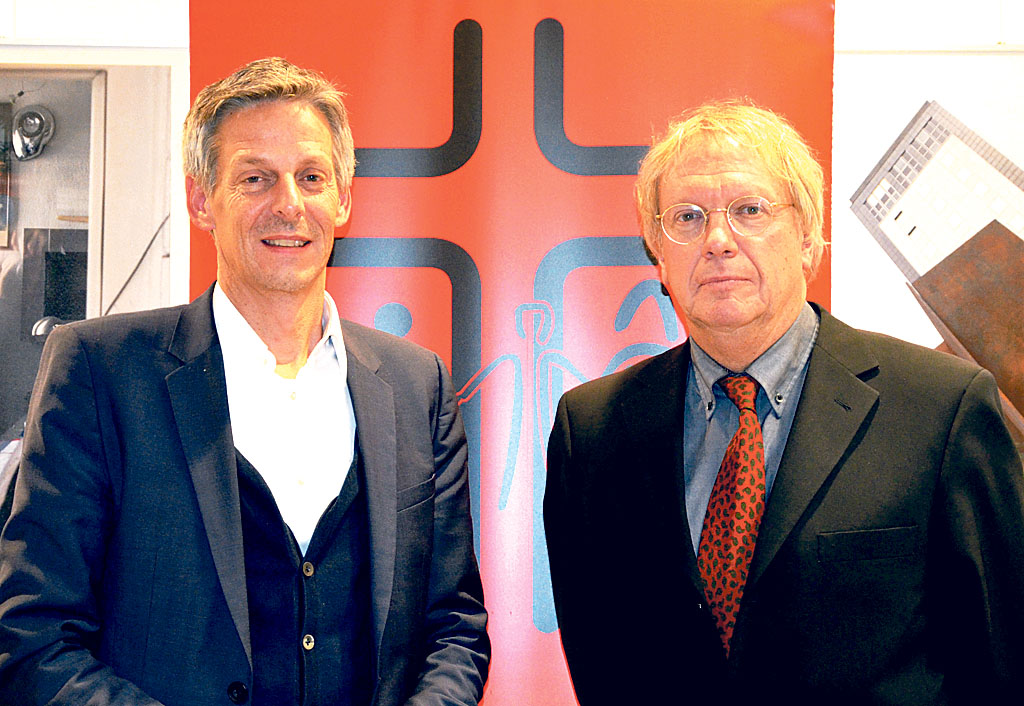Welche Friedensverantwortung hat die Kirche heute? Nach Antworten auf diese aktuell drängende Frage suchten die Solidarische Kirche Westfalen/Lippe und die Evangelische Stadtakademie Bochum während ihrer gemeinsamen Jahrestagung.
Kriegerische Konflikte wohin man schaut: In der Ukraine, in Nigeria, Syrien, Irak und Libyen. Und terroristische Gruppen, wie der IS in Syrien und dem Irak oder Boko Haram in Nigeria, halten die Welt in Atem.
„In bestimmten Situationen kann rechtserhaltende Gewalt in Form militärischer Nothilfemaßnahmen von der Kirche befürwortet und von Christen unterstützt werden.“ Diese These vertrat an diesem Abend Hans-Richard Reuter, Professor für Theologische Ethik an der Uni Münster und Direktor des Instituts für Ethik und angrenzende Sozialwissenschaften. Reuter verwies auf die Denkschrift der EKD „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“, an deren Abfassung er beteiligt war.
Den Schutz vor Gewalt, die Förderung der Freiheit, den Abbau von Not und die Anerkennung kultureller Verschiedenheit bezeichnet die Friedensdenkschrift als die Grundelemente eines gerechten Friedens. Im Konzept des gerechten Friedens gelte der Vorrang für die Option der Gewaltfreiheit. „Allerdings gilt auch im internationalen Rahmen: Recht ist notfalls auf zwangsbewehrte Durchsetzbarkeit angewiesen. Deshalb müssen in der Perspektive einer auf Recht gegründeten Friedensordnung Grenzsituationen mit bedacht werden, in denen sich die Frage nach einem erlaubten Gewaltgebrauch stellt“, führte Reuter in seinem Vortrag aus. „Wer militärisch eingreift, um nicht töten zu lassen, muss selbst bereit sein, zu töten. Als Christinnen und Christen sagen wir, dass er damit vor Gott Schuld auf sich nehmen muss.“ Nach den moralischen und rechtlichen Regeln der Kriegführung müsste sich die Intervention dabei auf militärische Ziele beschränken und die Zivilbevölkerung schonen. Reuter betonte außerdem, dass der Einsatz von Bodentruppen nicht unter allen Umständen ausgeschlossen werden könne, „wenn es wirklich und effektiv um den Schutz bedrohter Bevölkerungsgruppen geht“.
Gibt es Kriterien einer Ethik rechtserhaltender Gewalt? Professor Fernando Enns ist Mennonit und Leiter der Arbeitsstelle „Theologie der Friedenskirchen“ am Fachbereich Evangelische Theologie der Uni Hamburg. Er vertrat die These, dass vorrangig nach einem Weg gesucht werden müsse, der einen nachhaltigen gerechten Frieden befördern könne. Denn heute geht es seiner Ansicht nach nicht mehr um Kriege zwischen Staaten, sondern immer mehr um Machteinfluss durch Ressourcensicherung, sogenannte Stellvertreterkriege oder um Konflikte durch fundamentalistische Verblendungen religiöser, ideologischer oder politischer Natur.
Enns plädierte dafür, einen neuen Weg zu gehen, der sich gerade nicht der scheinbaren Alternativlosigkeit von militärischem Eingreifen einerseits und „nichts tun“ andererseits aussetze. Neue ökumenische Denkhorizonte des gerechten Friedens müssten her, es müsse eine neue friedensethische Perspektive im Sinne eines von Gewaltanwendung befreiten Lebens entwickelt werden.