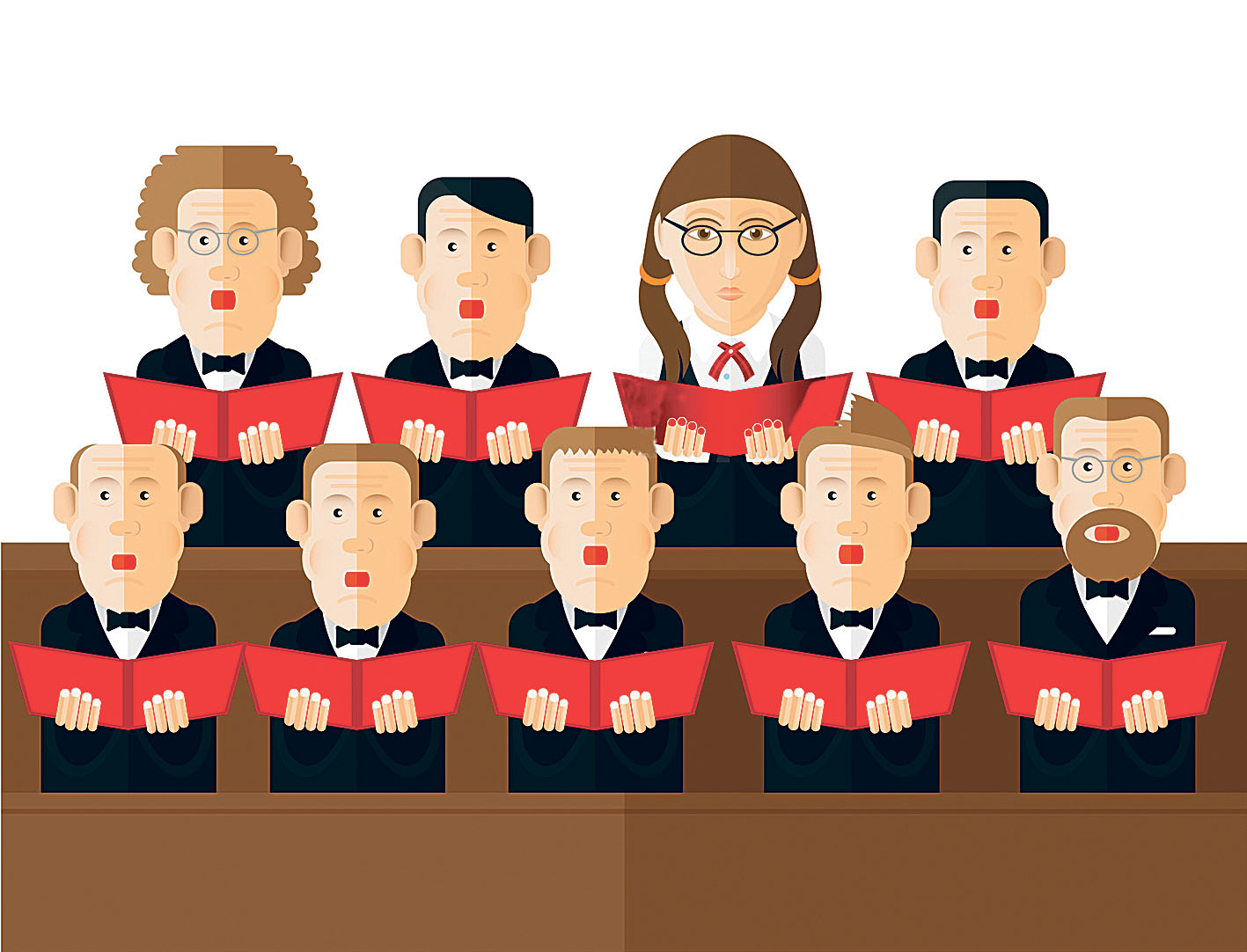Von Gertie Polith
Dichtende und komponierende Frauen hat es zu allen Zeiten gegeben, aber öffentlich wahrgenommen wurden sie kaum. Historisch betrachtet war es die Reformation, die neben vielen Erschütterungen auch an dieser ehernen Grundfeste rührte, Frauen behutsam als intellektuelle Mitgestalterinnen aufnahm und zumindest im häuslich geselligen Rahmen zum geistigen Disput zuließ.
Und auch deren schöpferische Beiträge fanden Anerkennung. Das mochte teils ganz pragmatische Ursachen haben: Die neue Gottesdienst-Agende verlangte Materialien, volkssprachliche Texte, dazu neue Melodien, der Bedarf war immens. Martin Luther hob ja bekanntlich die „klingende Verkündigung“ auf ein exponiertes Podest. Und bediente sich gerne der geistlichen Poeme der Dichterinnen in seinem Umfeld.
Frauen als Künstlerinnen blieben oft ungenannt
Die erste christliche Lyrikerin, die er in seiner Lied-Sammlung aufnahm, war Elisabeth Cruciger (auch Kreuziger), geboren um 1500 in Hinterpommern und bereits mit 35 Jahren in Wittenberg verstorben. Die ehemalige Nonne war eine gute Freundin von Katharina von Bora. Freilich – auch da galt das Verdikt öffentlicher „Unsichtbarkeit“: Ihr Lied „Herr Christ, der einig Gotts Sohn“ (EG 67) brachte ihr vom eigenen Ehemann das gönnerhafte Lob „So, als hatte es ein Mann geschrieben“ ein; und eine Veröffentlichung unter dessen Namen.
Diese Vorgehensweise hat wahrscheinlich unzählige Geschwister. So dass man eigentlich nur mutmaßen kann, dass allerhand weibliche Handschrift bei der reformatorischen Neugestaltung der Liederlandschaft im Spiel war. Vor allem innerhalb anonymisierter Quellen, wie etwa dem Liedschatz der „Böhmischen Brüder“, ist mutmaßlich Schwesterliches verborgen.
Eine der produktivsten Lieferantinnen etwas späterer Liedausgaben, die in nachreformatorischer Zeit wie Pilze aus den Druckereien sprossen, war die Adelige Ämilie Juliane von Schwarzberg-Rudolstadt (1637 – 1706). Allein 587 geistliche Lieder dichtete die Gräfin, und zwei ihrer Strophen-Poeme finden sich auch heute noch im Evangelischen Gesangbuch: „Bis hierhin hat mich Gott gebracht“ (EG 329) und „Wer weiß, wie nahe mir mein Ende“ (EG 530).
In adeligen Kreisen des 17. bis 19. Jahrhunderts war es üblich, auch den Frauen eine – zumindest musisch ausgerichtete – Bildung angedeihen zu lassen. Fremdsprachenkenntnisse, ergänzt durch Literaturunterweisung und Klavierspiel zählten zum Grundkanon. Die in der Oberlausitz geborene Henriette Maria Luise von Hayn (1724-1782), geprägt durch die Herrnhuter Brüdergemeinde, zählt zu diesem Kreis; ihr verdanken wir EG 652 „Weil ich Jesu Schäflein bin“.
Trauerode für eine liebe Freundin
Einige Generationen später machte Gräfin Eleonore zu Stolberg-Wernigerode (1835-1903) von sich reden. Ihr Gedicht „Das Jahr geht still zu Ende“ findet sich im Stammteil des EG (Nr. 63) und verleiht der Hoffnung auf Erlösung auf berührende Weise beredten Ausdruck. Es ist eine Trauerode auf den Tod einer lieben Freundin. Sehr persönlich, aber dennoch hochkarätige Lyrik.
Das Leben ihrer Zeitgenossin Anna Thekla von Weling (1837-1900) rückt einmal mehr die Ambivalenz zwischen schriftstellerischer Ambition und Öffentlichkeitswahrnehmung in den Blick. Die Autorin, Tochter einer schottischen Hofdame und als solche im Korsett adeliger Etikette erzogen, gleichzeitig mit einer gewissen Weltläufigkeit ausgestattet, wird angeregt durch vielfache geistige Impulse – Erweckungstheologie in Schottland, Herrnhuter Brüdergemeinde in der Lebensstation Neuwied. Sie leitet während des deutsch-französischen Kriegs in Bonn ein Lazarett, adoptiert Waisenkinder und gründet schließlich im Saale-Kreis eine Kleinkinderschule. Gleichzeitig veröffentlicht sie Gedichte, religiöse Erzählungen und Romane; nicht unter ihrem Namen, sondern mit dem Pseudonym Hans Tharau. Ihr mutiger Enthüllungsroman „Die Studiengenossen“ wird ihr dennoch 1882 zum Verhängnis. Sie muss Bonn verlassen. Im Evangelischen Gesangbuch ist sie mit „Die Kirche steht gegründet allein auf Jesu Christ“ (EG 264) vertreten.
Veröffentlichungen unter männlichem Pseudonym
Auch die Pfarr- und Lehrerhäuser waren ein fruchtbarer Boden für weibliche Kreativität. Prominentes Beispiel hierfür ist Wilhelmina (Minna) Amalie Koch (geborene Schapper, 1845-1898). Sie ist eine der nur vier Komponistinnen, die im Stammteil des Evangelischen Gesangbuchs Aufnahme fanden.
Aufgewachsen in einem Pfarrhaus in Bad Münster am Stein, später Wetzlar, Koblenz und schließlich Wittenberg, wo der Vater zum Direktor des Königlichen Predigerseminars berufen worden war, wuchs sie auf in der lebendigen Auseinandersetzung mit den Schriften Martin Luthers und Philipp Melanchthons, aber auch musikalisch vorzüglich und vielseitig gefördert. Ein Gedicht von Adolf Krummacher „Stern, auf den ich schaue“, hat sie zu einer bis heute populären Melodie inspiriert (EG 407).
Nur vier Komponistinnen im Stammteil
Die lettische Dichterin Julie Katharine Hausmann (1826-1901), der wir das geliebte „So nimm denn meine Hände“ (EG 376) verdanken, wuchs mit fünf weiteren Schwestern im Haushalt eines Gymnasiallehrers auf. Sie immerhin hat es geschafft, ihre Gedichtsammlungen zu Lebzeiten und mit eigenem Namen unter die Leute zu bringen. Unter dem Titel „Maiblumen – Lieder einer Stillen im Lande“ erschien sie 1862; ein 700 Seiten starkes Andachtsbuch brachte 1899 ebenfalls gute Verkaufserlöse, die sie regelmäßig karitativen Einrichtungen spendete.
Im 19. Jahrhundert, geprägt von gegensätzlichen Strömungen, emanzipierten sich vor allem die Frauen des gebildeten Großbürgertums. Führten literarische Salons, dichteten, komponierten, exponierten sich als Künstlerinnen. Prominente Beispiele gibt es zuhauf, die Pianistin Clara Schumann etwa oder die Komponistin Fanny Hensel, die Schwester Felix Mendelssohns.
Deren Schwägerin Luise Hensel (1798-1876) konvertierte 20-jährig vom lutherischen zum katholischen Glauben; eine außergewöhnlich attraktive und mit „schöner Wesensart“ ausgestattete Dame. Die Männer lagen ihr zu Füßen. Dass es gerade Dichter und Intellektuelle waren, die sich unsterblich in sie verliebten, untermauert ihre enorme geistige Ausstrahlung. Luise pilgerte, arbeitete in tätiger Nächstenliebe, gründete Armenhäuser. Und schrieb. Die Kopfstrophe eines ihrer berühmtesten Gedichte ist der Abendgebet-Klassiker schlecht: „Müde bin ich, geh zur Ruh“ (EG 484).
Im 20. Jahrhundert werden Frauen hörbarer
Eine weitere Stammteil-Melodie von weiblicher Hand stammt von Frieda Helene Fronmüller (1901 – 1992). Sie war Kantorin an der St. Michaelskirche zu Fürth. Als erste Frau in Deutschland wurde ihr 1955 der Titel Kirchenmusikdirektorin zuerkannt. Zu den Versen von „Freuet euch der schönen Erde“ von Philipp Spitta hat sie die Melodie geschrieben (EG 510). Weitere Melodien schufen die aus Jamaika stammende Musikerin Doreen Potter (1925-1980) (Kommt mit Gaben, EG 229) und die niederländische Komponistin Tera de Marez Oyens (1932-1996) (Solang es Menschen gibt auf Erden, EG 427).
Im Regionalteil findet sich noch eine Melodie der israelischen Komponistin und Choreographin Sarah Levy-Tanai (1911-2005), die in ihrem umfangreichen Schaffen vor allem die Kultur ihrer jemenitischen Wurzeln aufnahm (EG 577, Kommt herbei, singt dem Herrn). Das mitreißende Mirjam-Lied schließlich, „Im Lande der Knechtschaft“ (EG 680), stammt aus der Feder der österreichischen Liedermacherin Claudia Mitscha-Eibl (geb. 1958).