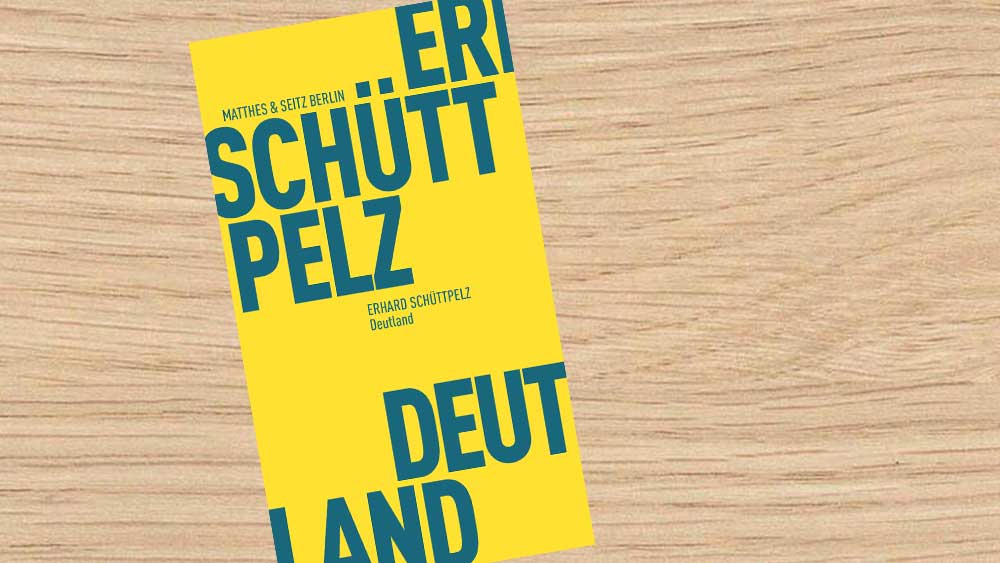Der Titel macht neugierig: Inwiefern ist Deutschland – darauf wird ja wohl angespielt – ein „Deutland“, ein Land, in dem alle Texte ohne Rücksicht auf Verluste interpretiert werden müssen? Da es in Kirche und Theologie immer wieder um das Interpretieren von Texten geht – von den biblischen Texten Alten wie Neuen Testaments beispielsweise Sonntag für Sonntag in der Predigt, aber auch von maßstabsetzenden Texten von Theologen wie Martin Luther im Gemeindekreis –, verlockt das Bändchen natürlich zusätzlich zum Lesen.
Es ging um mehr als Interpretation
Erhard Schüttpelz, der in Siegen Medientheorie lehrt, geht es um die Entwicklung der Geisteswissenschaften hin zu der heute dominanten Vorstellung, alles müsse interpretiert werden, und die Kunst der Interpretation sei die höchste Kunst. Der Autor kann zeigen, dass es noch im 19. Jahrhundert in den Geisteswissenschaften um viel mehr ging als nur um Interpretation, nämlich auch um Philologie und Geschichtswissenschaft: Umgang mit Geschriebenem meinte Rekonstruktion früher Stufen eines überlieferten Textes, Überprüfung des Realitätsbezuges eines Textes, neue Erzählung der in ihm berichteten Vergangenheiten – kurz: Kritik.
Diese Methode für den wissenschaftlichen Umgang mit der Bibel entstand in der frühen Neuzeit – und heißt in den deutschen Theologischen Fakultäten daher oft noch ganz klassisch: historisch-kritische Methode. Der neuzeitliche protestantische Fundamentalismus entstand als Reaktion auf die Entwicklung dieser Methode.
Provokante These
Schüttpelz formuliert nun die provokante These, dass die historisch-kritische Methode erst im 20. Jahrhundert durch die hermeneutische, ausschließlich auf das Interpretieren konzentrierte Methode abgelöst wurde, in der es auf das Nacherleben und nicht mehr auf die philologisch-historische Kritik ankommt. Im 20. Jahrhundert proklamierte man endgültig Schleiermacher (zu Unrecht) zum Kirchenvater dieser Methodenwende.
Im 21. Jahrhundert gelten die Reste der alten Methode in den Bibelwissenschaften und den historischen Disziplinen als hoffnungslos wenderesistente und wenig modernitätsaffine Überbleibsel. Schüttpelz sieht als Folge dieser Verschiebung das Überhandnehmen von subjektiven Deutungen, die die ursprünglichen Autorinnen und Autoren überflüssig machen. Provozierende Thesen, die mit Sicherheit breit diskutiert werden dürften – hoffentlich auch in Theologie und Kirche.
Erhard Schüttpelz, Deutland, Reihe Fröhliche Wissenschaft 219, Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2023, 187 Seiten, 15 Euro.