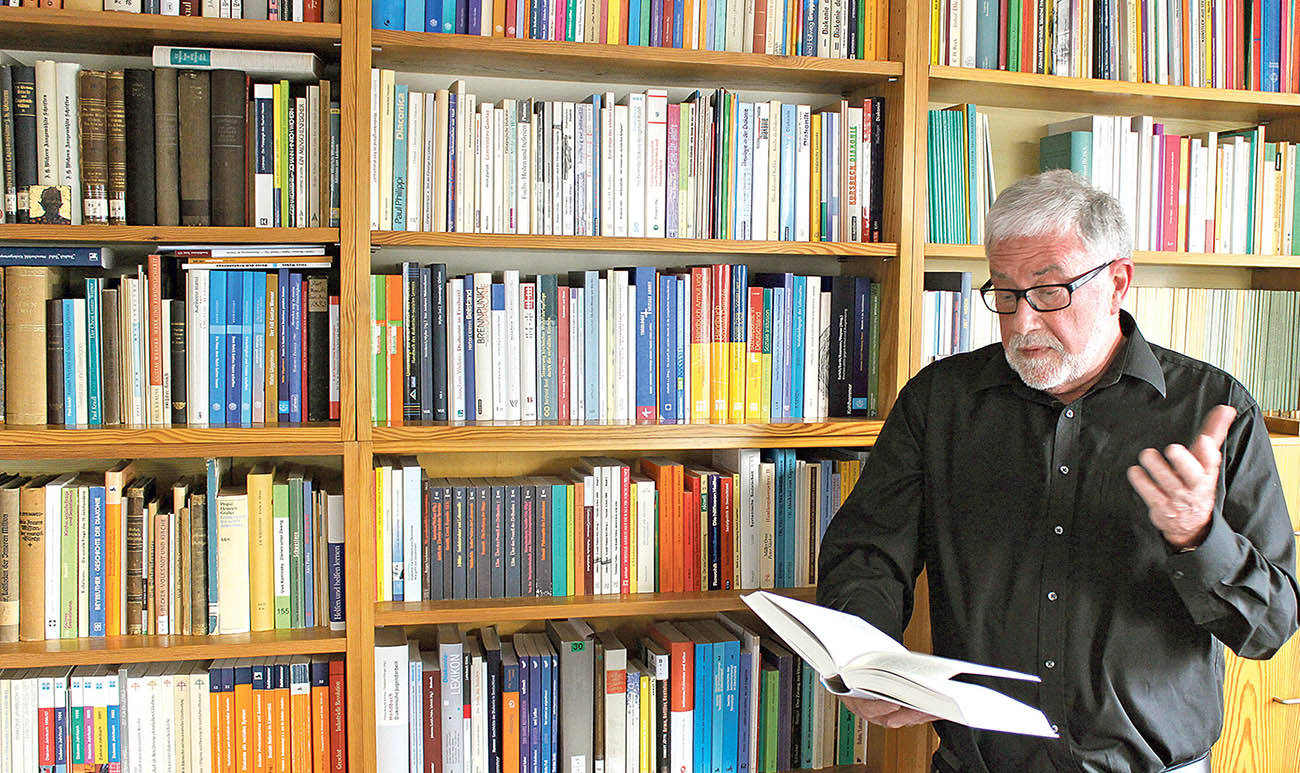Mit 2400 Studierenden ist die Evangelische Hochschule (EvH) Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum die bundesweit größte ihrer Art in kirchlicher Trägerschaft. Die Lehr-, Forschungs- und Ausbildungsstätte im Herzen des Ruhrgebiets ist hoch anerkannt über die Grenzen der Fachwelt hinaus. Hohe Wertschätzung genießt sie auch bei den jungen Menschen, die das breitgefächerte Angebot im Gesundheits- und Sozialwesen und der Gemeindepädagogik nutzen. Nach EvH-Angaben rund 450 nehmen jedes Jahr ihr Studium dort auf. Die große Beliebtheit belegt auch die anhaltend hohe, die Kapazitätsgrenzen regelmäßig um ein Vielfaches übersteigende Bewerberzahl.
Nicht ohne Grund also ist Gerhard K. Schäfer dankbar und sichtlich stolz auf diese Hochschule, deren Werdegang der promovierte Theologe miterlebt und maßgeblich mitgestaltet und geprägt hat. Miterlebt, seit er hier 1998 die Professur für Gemeindepädagogik und Diakoniewissenschaft übernahm. Mitgestaltet und geprägt, seit er ihr 2007 bis zu seinem Ruhestandseintritt jetzt als Rektor vorstand. Am 5. April wird der inzwischen erfolgte Stabwechsel in dieser Verantwortung an seine Nachfolgerin Sigrid Graumann in Bochum auch offiziell vollzogen.
Beim Gespräch in seinem Domizil – einem über 100 Jahre alten Pfarrhaus im Westen von Dortmund –, das er mit seiner Familie seit fünf Jahren bewohnt, erinnert er sich noch gut an die Zeit, die den entscheidenden Schub zu grundlegender Veränderung bewirkte und die Bildungsstätte zu dem werden ließ, was sie heute ist: der „Bologna-Prozess“ vor zehn Jahren. Der hatte die europaweite Harmonisierung von Studiengängen und -abschlüssen sowie die internationale Mobilität der Studierenden zum Ziel und löste damit eine tiefgreifende Hochschulreform aus, nicht zuletzt auch an der EvH.
Bologna-Prozess ebnete den Weg in die Zukunft
Schäfer: „Das um Masterstudiengänge und Promotionsmöglichkeiten erweiterte Angebotsspektrum eröffnet begabteren Studierenden ganz andere Karrieremöglichkeiten.“ Ein Prestige- und Attraktivitätsgewinn. Auch aufs Ganze gesehen hat sich nach seiner Wahrnehmung das Lehren und Lernen in der Folge „deutlich verändert“. Sehr zum Positiven für die EvH. „Interdisziplinarität und Internationalität“, also die Einbeziehung von Erkenntnissen aus anderen Fachbereichen und der Austausch und Kontakt mit Wissenschaflern und Studierenden aus anderen Ländern, nennt Schäfer die Stichworte, die in Bochum mit Leben gefüllt werden: „Die Berufsaussichten der Studierenden, die hier die Ausbildung durchlaufen, sind außerordentlich gut.“
Gut gerüstet sieht der Theologe die Hochschule gerade mit Blick auf die Herausforderungen, denen sich die Diakonie seit den 1990er Jahren politisch gewollt unter Wettbewerbsbedingungen mit anderen sozialen Anbietern auf dem Sozialmarkt stellen muss. Langfristig behaupten werde sie sich aber nur, wenn sie sich so profiliert, dass es ihr gelingt, „sozialwissenschaftlich begründete Fachlichkeit, Ökonomie und die Potenziale des christlichen Glaubens und christlicher Tradition positiv zueinander in Beziehung zu setzen“, ist seine These. Und dafür brauche sie eben zunehmend Mitarbeitende, „die genau dies können“.
Dass diese Qualifikation nicht vom Himmel fällt, dessen ist Schäfer sich sehr bewusst, wenn er auf das Spannungsverhältnis der verschiedenen Logiken von Fachlichkeit, Ökonomie und Religiosität zueinander verweist, die dabei aufeinanderprallen. Hier das richtige Verhältnismaß zu finden, darum gehe es in der Ausbildung an der EvH. Dort müsse es grundgelegt werden, damit dieser Abstimmungsprozess gelingt.
Die besonderen Schwierigkeiten erläutert Schäfer am Beispiel der Fachrichtung Sozialarbeit. Traditionell sei es an anderen Hochschulen weder auf Seiten der Lehrenden noch der Lernenden selbstverständlich, dabei auch Betriebswirtschaftliches oder die Potenziale christlicher Tradition mitzudenken. Noch bis in die 1990er Jahre hinein wurde alles Religiöse ausgeblendet und galt Ökonomisierung als etwas rein Negatives, erinnert sich Schäfer.
Die EvH bemühe sich im Unterschied dazu um eine „Kultur der Interdisziplinarität“. Es gehe darum, Räume zu eröffnen über enge Fachgrenzen hinaus, um die überkommenen Vorurteile zu überwinden, die den Blick verstellen für die positiven Möglichkeiten, die daraus erwachsen können. So verstellen, wie einst die Zwischenwand in seinem Arbeitszimmer im Dachgeschoss des alten Pfarrhauses, die bei der Renovierung weichen musste. Ergebnis: ein großer lichter Raum mit viel Gestaltungspotenzial.
Dieses Bild vor Augen hat man mit Blick insbesondere auf die unternehmerische Diakonie den Eindruck, dass da noch so manche Zwischenwand als Hindernis steht. So stellt Schäfer immer wieder fest, dass hier die Theologie der Betriebswirtschaft untergeordnet wird, sie zum Teil nur „eine Alibifunktion“ hat. „Um es hart zu sagen: Sie beschränkt sich manchmal auf so was wie eine Präambel-Theologie mit sehr allgemeinen Aussagen, die sich auf das christliche Menschenbild beziehen, statt ihre Grundsätze so zu operationalisieren, dass sie in ihrer Relevanz für helfendes Handeln einer Mitarbeiterin auch deutlich werden.“ Heißt: in der Praxis bleibt der christliche Bezug auf der Strecke.
An mancher Stelle ist etwas auseinandergebrochen
Schäfer verweist auf den katholischen Sozialverband Caritas als positives Gegenbeispiel, wo das durchdekliniert werde bis hin zu sozialen Innovationen. Dahinter seien viele Einrichtungen der Diakonie zurückgeblieben. Negativ hinzu komme als Zweites, dass Entscheidungen, bei denen der Ökonomie gezwungenermaßen ein gewisser Vorrang eingeräumt werden müsse, etwa wenn es um die Existenzsicherung eines Unternehmens gehe, in der Mitarbeiterschaft „wenig transparent“ gemacht würden.
Man spürt, wie unerträglich er es empfindet, „dass gerade in evangelischen Häusern, die ja auch auf Partipation setzen, diese Kultur häufig nicht ausgeprägt ist“. Und Schäfer lässt keinen Zweifel daran, dass eine Diakonie – „und diese Probleme haben wir“ – auf Dauer ihre Glaubwürdigkeit einbüßt, wenn sie „nur nach außen etwas proklamiert und anwaltschaftlich fordert, was sie nach innen selbst aber nicht vollzieht“. Da ist an mancher Stelle etwas auseinandergebrochen.
Die große Chance auf Heilung sieht der Wissenschaftler in der politisch geforderten Sozialraumorientierung des Hilfehandelns. Wenn die unternehmerische Diakonie, die ihre Kompetenzen im Wohnumfeld der Menschen einbringt, die örtlichen Kirchengemeinden aktiv mit einbezieht. Und wenn die Kirchengemeinden ihrerseits Impulse aus der professionellen diakonischen Arbeit aufgreifen und in ihre diakonische Gemeindearbeit einfließen lassen. Inwieweit das gelingt, hängt nicht zuletzt am Willen beider Seiten, ihre Kompetenzen produktiv aufeinander zu beziehen.
Schäfer lässt keinen Zweifel daran, dass hier noch viel Luft nach oben ist. Gebraucht würden Menschen mit Vermittlungskompetenzen. Menschen, wie sie die Evangelische Hochschule mit ihrer Interdisziplinarität, ihrer Praxisbezogenheit und ihrer wissenschaftlichen Fundierung ausbildet.