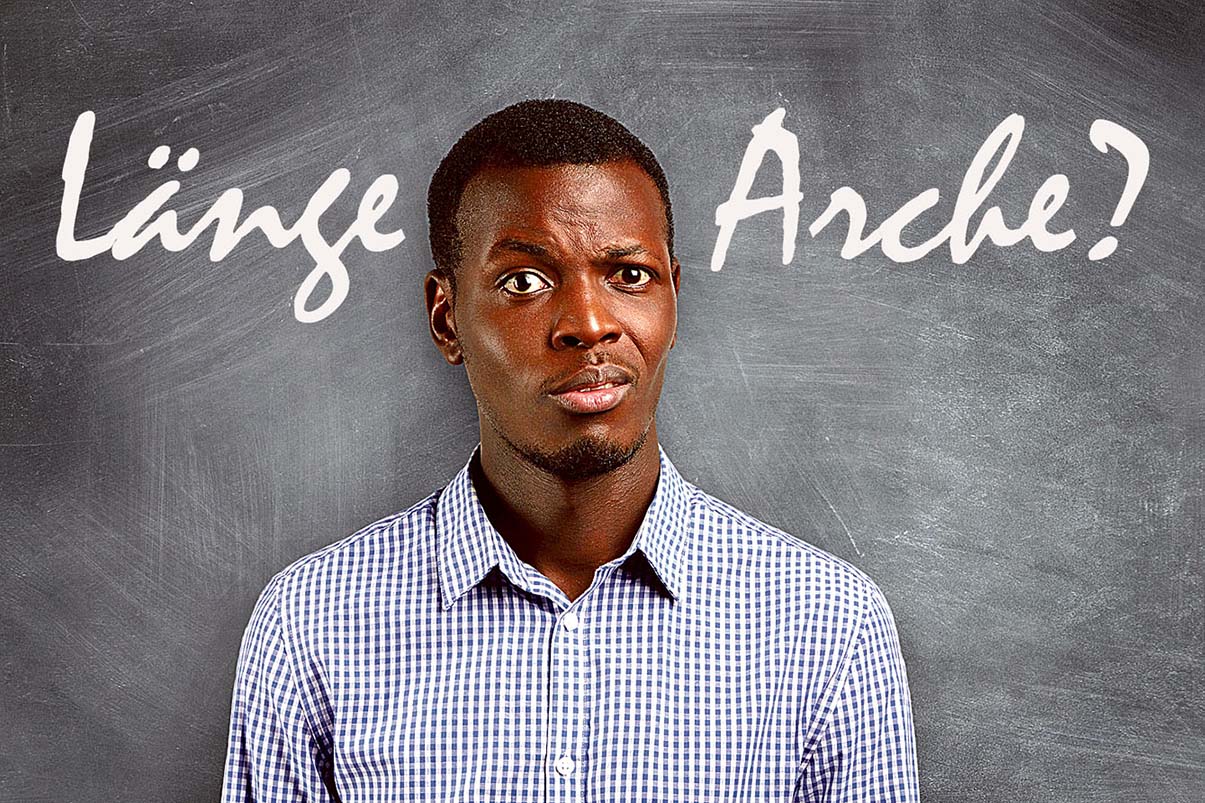„Wie heißen die beiden Söhne im Gleichnis vom Verlorenen Sohn?“ Pfarrer Gottfried Martens aus Berlin-Steglitz kann diese Frage nicht beantworten. Sein iranischer Täufling noch weniger: In der Bibel werden die Namen der beiden Söhne überhaupt nicht erwähnt. Der Iraner allerdings könnte deswegen nun in seine Heimat abgeschoben werden. Weil er in seiner Anhörung vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Berlin diese Frage nicht beantworten konnte, glaubte ihm das Amt nicht, dass er wirklich und aus voller Überzeugung zum christlichen Glauben konvertiert ist.
Wer kennt den Namen des Verlorenen Sohnes?
Ein Einzelfall? Nein. Bei dem zur Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) gehörenden Pfarrer Martens häufen sich die Fälle von Konvertiten, die einen negativen Asylbescheid erhalten haben. „Und fast immer finden sich in den Anhörungsprotokollen Belege dafür, dass Anhörer, Dolmetscher und Entscheider, also alle mit dem jeweiligen Fall betrauten Personen, selbst überhaupt keine Ahnung von dem haben, wonach sie fragen“, sagt Martens. So verwechselte eine Anhörende das Apostolische Glaubensbekenntnis mit dem Vater Unser. Ein Dolmetscher übersetzte das Osterfest mit dem Begriff „Schweinefleischfest“. Und ein Konvertit scheiterte an der Frage nach dem Geburtstag Martin Luthers – den vermutlich die wenigsten lutherischen Christen in Deutschland auf Anhieb nennen können.
Ähnliche Erfahrungen gibt es auch im Bereich der Lippischen Landeskirche. „Juristisch mag es eine gewisse Berechtigung geben, festzuhalten, ob jemand zum christlichen Glauben konvertiert ist“, sagt Dieter Bökemeier, Superintendent in Detmold und Flüchtlingsbeauftragter der Lippischen Landeskirche. „Denn für die Frage, ob jemand in sein Herkunftsland zurückgeschickt werden kann, ist ja entscheidend, ob er dort sicher leben könnte.“ Und das sei oft nicht mehr gewährleistet, wenn jemand seinen christlichen Glauben offen lebte. „Allerdings“, so Bökemeier, dürfe daraus kein „Glaubens-TÜV“ werden. Die Sorge, Pfarrer könnten die Taufe zu schnell oder gar leichtfertig erteilen, um die Wahrscheinlichkeit auf Bleiberecht für Flüchtlinge zu erhöhen, hält er für unbegründet. Etwa 30 Taufen habe es im laufenden Jahr in Lippe unter Flüchtlingen gegeben, die meisten habe er selbst durchgeführt. Jeder Bewerber habe zuvor einen dreimonatigen Glaubenskurs durchlaufen. „Ich erlebe diese Menschen als ernsthaft und tief religiös“, so Bökemeier.
„Es ist zwar richtig, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die Gerichte das Recht und die Pflicht haben, bei Konversionen von Flüchtlingen die Hintergründe zu prüfen“, erklärt Andreas Duderstedt, Pressesprecher der Evangelischen Kirche von Westfalen. „Die Behörden müssen dabei aber anerkennen, dass der taufende Pfarrer oder die taufende Pfarrerin auf der Grundlage der Kirchenordnung die Ernsthaftigkeit des Glaubensübertritts ebenfalls geprüft hat.“
Auch nach Duderstedts Informationen kommt es in Asylverfahren immer wieder zu Befragungen in diese Richtung. Verlässliche Zahlen lägen derzeit nicht vor. Aber letztlich stelle sich damit die Frage nach der Sachkompetenz in Fragen des christlichen Glaubens. „Es ist jedenfalls sehr hilfreich, wenn die Asylsuchenden bei den Befragungen von ihrer Pfarrerin oder ihrem Pfarrer begleitet werden“, so Duderstedt.
Auf der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Bayerns berichtete Oberkirchenrat Michael Martin, dass auch dort das Bundesamt „Glaubensprüfungen“ bei Flüchtlingen durchführe. „Unbestritten ist: Die Taufe gehört zum Kernbereich kirchlichen Handelns“, sagte Martin. „Als solche ist sie einer staatlichen Überprüfung entzogen.“ Aus kirchlicher Sicht halte man fest, dass Glaube mehr sei, als die Ansammlung von Faktenwissen. Deshalb könne er nicht überprüft werden. Martin berichtete davon, dass einem Täufling dazu geraten wurde, seinen Glauben bei einer Abschiebung in den Iran doch einfach zu verleugnen. „Völlig zu Recht fragte ein Täufling nach seiner Anhörung: Wie kann es sein, dass ein oft nicht christlicher Mitarbeiter des BAMF, übersetzt von einem muslimischen Afghanen, die Entscheidung über meinen Glauben fällt?“ In der anschließenden Debatte äußerte sich auch der EKD-Ratsvorsitzende, Heinrich Bedford-Strohm. „Als ich davon gehört habe, war ich entsetzt“, sagte Bedford-Strohm.
Der Verdacht: Taufe aus taktischen Gründen
Auf Nachfrage dieser Zeitung wollte sich das BAMF nicht zu den konkret angesprochenen Fällen äußern. Ein Sprecher betonte jedoch, dass im Rahmen der persönlichen Anhörung die näheren Umstände des Glaubenswechsels geprüft würden. „Die Taufbescheinigung bestätigt, dass ein Glaubensübertritt stattgefunden hat, sie sagt aber nichts darüber aus, wie der Antragsteller seinen neuen Glauben bei Rückkehr in sein Heimatland voraussichtlich leben wird und welche Gefahren sich hieraus ergeben“,sagte der Sprecher. „Die Klärung dieser Frage ist Bestandteil der persönlichen Anhörung.“
Der Entscheider müsse beurteilen, ob der Glaubenswechsel des Antragstellers aus asyltaktischen Gründen oder aus echter Überzeugung erfolgt sei. „Das Bundesamt zweifelt aber den durch Taufbescheinigung nachgewiesenen Glaubenswechsel an sich nicht an“, so der Sprecher. Es werde generell unterstellt, dass eine sorgfältige Taufbegleitung von Seiten der christlichen Gemeinden erfolgt sei. „Für Befragungen in der Anhörung zur Konversion gilt, dass sie nicht auf ein reines Glaubensexamen hinauslaufen dürfen“, so der Sprecher. Allerdings werde von einem Konvertiten durchaus erwartet, dass er ausführlich schildern könne, welche Beweggründe er für die Konversion hatte und welche Bedeutung die neue Religion für ihn persönlich habe.