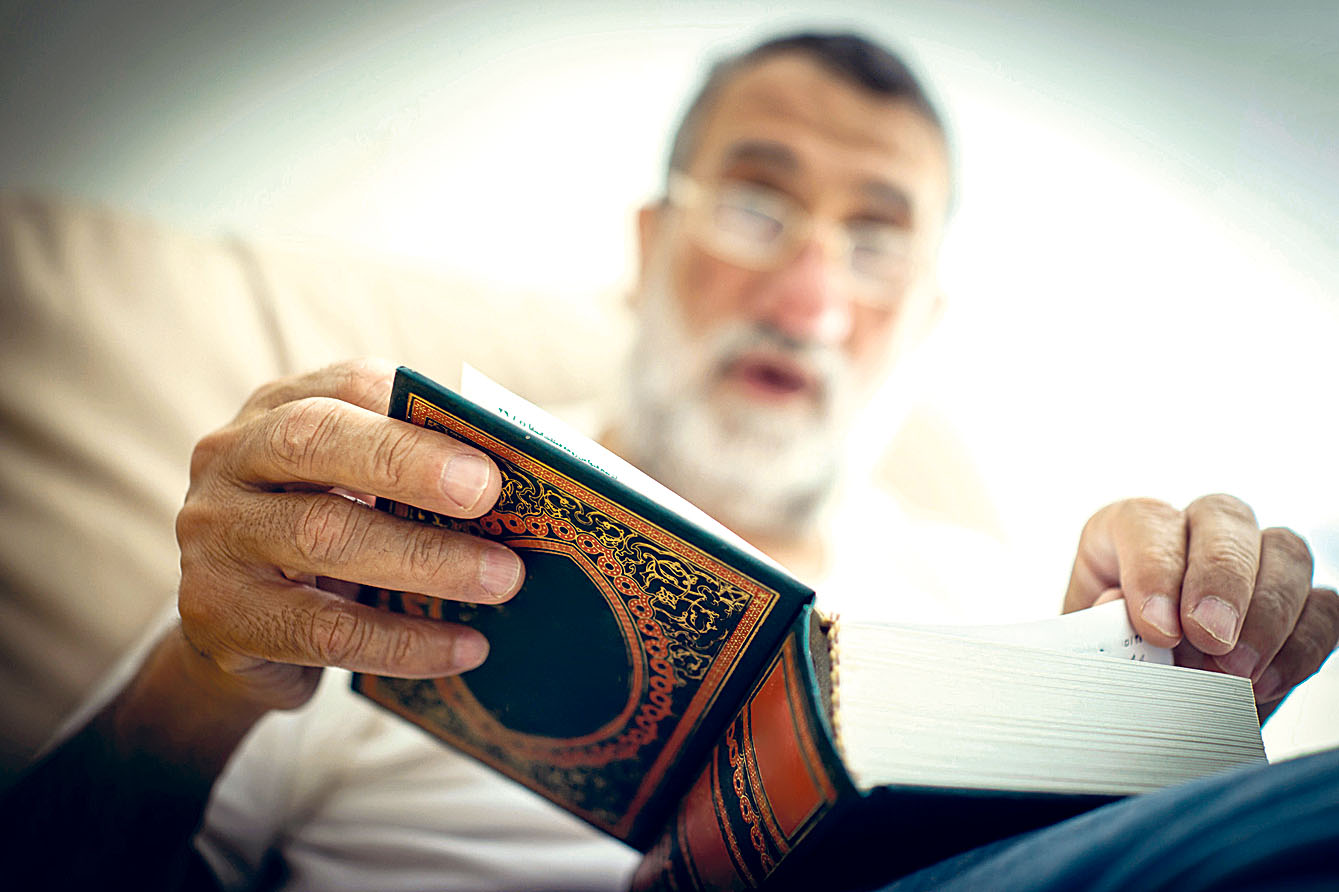Mit seinem neuen Buch „Der Islam in der Krise. Eine Weltreligion zwischen Radikalisierung und stillem Rückzug“ (Patmos Verlag, 192 Seiten, 19 Euro) sorgt der deutsche Religionswissenschaftler Michael Blume derzeit für Diskussionen. Sein Befund: In Zeiten von Terror und Fanatismus wenden sich immer mehr Muslime von der Religion ab. Noch passiert das meist im Stillen, erläuterte Blume im Interview mit Christoph Schmidt.
Herr Blume, wie lässt sich die „Krise des Islam“ zusammenfassen?
Ihre Wurzeln reichen weit zurück. Durch das Verbot des Buchdrucks ab 1485 durch Sultan Bayazid II. erstarrt die bis dahin führende islamische Zivilisation. Während Europa durch das Lesen über Reformation und Aufklärung voranstürmt, entwickelt sich das Osmanische Reich nicht weiter. Ab dem 19. Jahrhundert wird die islamische Welt dann von europäischen Kolonialmächten überrannt, im 20. Jahrhundert verbündet sich der energiehungrige Westen mit autoritären Ölregimen wie Saudi-Arabien und Iran.
Mangels schlüssiger Erklärungen für den Niedergang verfallen sehr viele Muslime dem Glauben an weltweite Verschwörungen. Heute zerfleischen sich die islamischen Gesellschaften selbst, Sunniten gegen Schiiten und Radikale gegen Gemäßigte. Innerlich ziehen sich immer mehr Muslime vom Glauben zurück, Tausende konvertieren aber auch zum Christentum oder kehren zu alten Religionen wie dem Zoroastrismus zurück.
Worauf stützt sich Ihr Befund, dass die Frömmigkeit unter Muslimen zunehmend einem „stillen Glaubenszweifel" weicht?
Für eine Lossagung vom Islam drohen Muslimen vielerorts immer noch Gewalt oder Sankti-onen durch Gesellschaft und Familie, also wahrt man nach außen die Form. Aber immer mehr Muslime reduzieren ihr religiöses Engagement, halten sich von den Moscheen fern, beten weniger oder gar nicht mehr. Auch in arabischen Staaten wird mehr Alkohol denn je getrunken. Von den Muslimen in Deutschland betet kaum noch jeder dritte Senior über 60 täglich und kaum mehr jeder Fünfte unter 30.
Eine wachsende Zahl der Deutschen zum Beispiel türkischer und iranischer Herkunft bezeichnet sich in anonymen Umfragen als konfessionslos. Während noch 41 Prozent der aus der Türkei zugewanderten Frauen ein Kopftuch tragen, sind es unter ihren in Deutschland geborenen Töchtern nur noch 18 Prozent. Und in Verbänden wie dem Zentralrat der Ex-Muslime und im Internet vernetzen sich auch immer mehr Ex-Muslime.
Was genau wird da angezweifelt?
Genau wie Christen oder Juden fragen sich selbstverständlich auch Muslime: Gibt es Gott? Hat er sich in unserer Tradition offenbart? Stimmen die Gebote? Sind die frommen Prediger glaubwürdig? Heutige Muslime sehen nicht nur die Armut, Gewalt und Korruption ihrer Gesellschaften, sondern auch immer mehr Kriege und Terror im Namen des Islam. Doch ein immer größerer Teil vor allem der Gebildeteren kann und will die inneren Zweifel nicht länger unterdrücken. Auch deswegen verlassen immer mehr Menschen die islamischen Länder. Sie wollen endlich frei sein.
Spielt also das westliche Vorbild eine Rolle?
Ja, immer mehr Muslime sehen und erleben, wie weit Anspruch und Wirklichkeit gerade auch unter ihren vermeintlich Frommen auseinanderklaffen. Selbst Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan wissen heimlich, dass er und seine Familie sich entgegen aller islamischen Floskeln korrupt bereichern. Sie sehen den obszönen Reichtum und die Gewaltbereitschaft der saudischen Herrscherfamilien als „Hüter der heiligen Stätten“, während im Jemen und in Afrika auch die Kinder von Muslimen verhungern. Die Flüchtlingskrise war für viele Muslime ein Tiefpunkt: Das christliche Europa nahm Hunderttausende Schutzsuchende auf, während sich Sunniten und Schiiten gegenseitig ermordeten.
Wie reagiert das Gelehr-tenestablishment auf die Krise?
Wenn Menschen andere Gruppen als überlegen erfahren, reagieren sie mit Hassliebe. Sie wollen sein wie diese – und verachten sie zugleich dafür. Entsprechend beklagen viele Muslime bitterlich den westlichen Kolonialismus – und feiern zugleich die früheren, islamischen Eroberungen. Zur Erklärung des eigenen Niedergangs dienen dann Verschwörungsmythen, die sinnigerweise selbst nicht einmal mehr islamisch sind. Muslimische Verschwörungsgläubige glauben an Freimaurer, Illuminaten und die gefälschten „Protokolle der Weisen von Zion“.
Ist der übertriebene Rückgriff auf den Islam vieler erfolgloser Migranten eine Trotzreaktion auf das Erodieren der eigenen Religion oder schlicht eine Strategie zum Erhalt des eigenen angeknacksten Selbstbewusstseins?
Beides stimmt. In der Krise des Islam bleiben den Menschen oft nur zwei Wege: Sie können sich still aus der Religion zurückziehen oder durch weitere Verschwörungsmythen ihre Zweifel unter-drücken und dabei weiter radikalisieren. Besonders sichtbar wird die Zerrissenheit an den selbsternannten Salafisten. Noch um 1900 lehnten sie etwa Fotografien strikt ab. Heutige Salafisten können dagegen von digitalen Selfies und YouTube-Videos nicht genug bekommen, nur den Frauen verbie-ten sie es noch. Sie lehnen Zahnbürsten und Jeans ab, weil der Prophet sie nicht benutzte, wollen aber unbedingt Handys und Autos haben. Das Selbstmordattentat ist oft auch ein vermeintlicher Ausweg aus inneren Widersprüchen.
Welche Entwicklung prognostizieren Sie dem Islam?
Leider sehe ich noch kein schnelles Ende des „30-jährigen Krieges“ im Islam. Gerade auch Muslime in der westlichen Welt könnten dann ein Teil der Lösung sein, wenn sie statt auf Verschwörungsmythen auf Bildung und Wissenschaft setzen – auch wenn das erst einmal weh tut. Immerhin: Ich bekomme zu dem neuen Buch immer mehr Einladungen auch aus islamisch-theologischen Instituten und aus Moscheegemeinden. Eine arabische Zeitung hat ein Rezensionsexemplar bestellt.
Ob islamische Reformer in Zukunft eine Chance haben, bestimmen aber auch wir durch unseren Rohstoffverbrauch. An jeder Tankstelle und jedem Flughafen finanzieren wir selbst die Radikalen, über die wir uns dann beklagen. Und verkaufen dann auch noch unsere Technologien und Waffen an Ölregime in Arabien und Afrika. Das Verbrennen von Öl vergiftet nicht nur unsere Umwelt, sondern auch unsere Gesellschaften und Religionen.