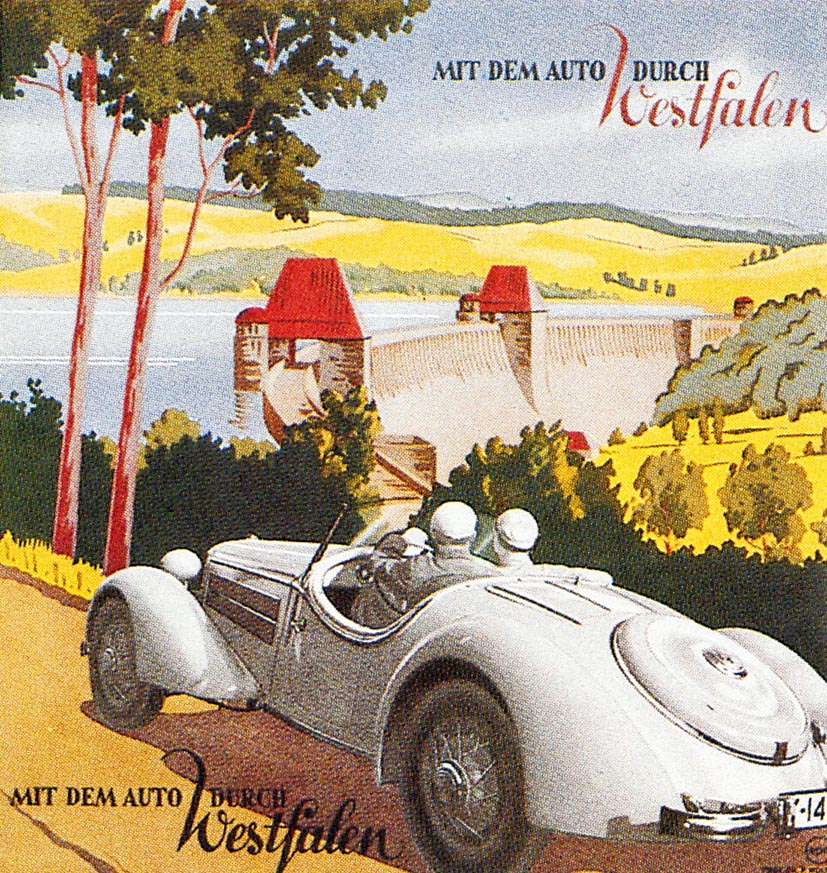Schwarz-gelbe und königsblaue Schals liegen in einem Raum ebenso einträchtig nebeneinander wie Wimpel und Trikots der beiden Ruhrgebietsvereine: Diese ungewohnte Szenerie bietet die Ausstellung „200 Jahre Westfalen“ im Dortmunder Museum für Kunst- und Kulturgeschichte, die am Freitag von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft eröffnet wird. „Die Fanartikel haben zwei Zwillingsbrüder zur Verfügung gestellt, der eine fiebert für Schalke, der andere für den BVB“, berichtet Kuratorin Brigitte Buberl. Es ist eine von vielen Episoden und Geschichten der Ausstellung, die vom Alltagsleben in der Region erzählen.
Die von Gotthard Kindler ist eine andere. Als der Bergmann seine letzte Grubenfahrt hinter sich hatte, nahm er sein gesamtes Arbeitszeug, so verschmutzt wie es war, mit nach Hause, um es dort zur Erinnerung aufzuhängen. Es wurde seither nie mehr gewaschen. Mit der Zechenschließung hatte er seinen Arbeitsplatz verloren, der für ihn mehr als nur einen Job bedeutet hatte. Die nachgestellte Bergmannswohnung zeigt, wie recht bescheiden die Menschen in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gelebt haben und der Fernseher erst der Mittelpunkt des Feierabends und später des Vorruhestands war.
„Das Ruhrgebiet war einst Motor für den wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Krieg“, sagt Matthias Löb, Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Inzwischen haben sich nach seinen Worten das Münster-, das Sauer- und auch das Siegerland zu Regionen mit starken Industriebetrieben entwickelt. Die Industriegeschichte Westfalens ist ganz eng mit Firmennamen wie Hoesch, Harkort oder Klönne verbunden. Die Schau erinnert zudem an den Freiherrn Gisbert von Romberg, der die erste Dampfmaschine zur Wasserhaltung in einem Bergwerk installieren ließ.
Wie eng in Westfalen Landwirtschaft und Industrie seit geraumer Zeit miteinander verbunden sind, wird ebenso in der Ausstellung thematisiert. Die Zeiten mühevoller bäuerlicher Handarbeit haben schon längst ein Ende gefunden und inzwischen sind hochtechnische Geräte im Einsatz, die vor allem von einem Hersteller aus dem Münsterland produziert werden, der zu den Weltmarktführern in der Landwirtschaft gehört.
Der Wandel der Wirtschaft in Westfalen, die einst auch stark von Möbelproduktion geprägt war und die auch heute noch von Eisen- und Metallverarbeitung bestimmt wird, gehört zu einem weiteren Schwerpunkt der Ausstellung, der ebenso wie das Thema Migration und Vielfalt noch eigens Berücksichtigung finden soll. Menschen aus 180 verschiedenen Nationen haben hier eine neue Heimat gefunden. Um diesen wichtigen Aspekten Raum schenken zu können, wird ein Teil im Laufe der Ausstellungsdauer bis zum 28. Februar entsprechend verändert, erklärt Kuratorin Buberl.
Fester Bestandteil bleibt indes der Blick auf den Beginn der Provinz Westfalen, die nach den Beschlüssen des Wiener Kongresses 1815 entstand. Zu den bedeutenden Männern, die die Region, ihre Verwaltung und ihre Struktur prägen sollten, gehören Freiherr vom und zum Stein sowie Oberpräsident Ludwig von Vincke, dessen Arbeitszimmer nachgebildet ist. Darüber hinaus widmet sich die Ausstellung Annette von Droste-Hülshoff, die die westfälische Literatur besonders geprägt hat.
„200 Jahre Westfalen“ mit insgesamt 800 Exponaten wendet sich darüber hinaus bekannten Klischees über Westfalen und die dort lebenden Menschen zu: Sie gelten als stur, arbeitsam, humorlos, eher rückständig und essen vor allem Pumpernickel. Dass der Schnaps einst eine viel größere Bedeutung besessen hat als Bier und wie Kneipen in früherer Zeit aussahen, das können Besucher der Ausstellung im Gastraum einer Schenke im altem Stil besichtigen.
• Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags 10-17 Uhr, donnerstags 10-20 Uhr und samstags 12-17 Uhr. Internet: www.200jahrewestfalen.jetzt.